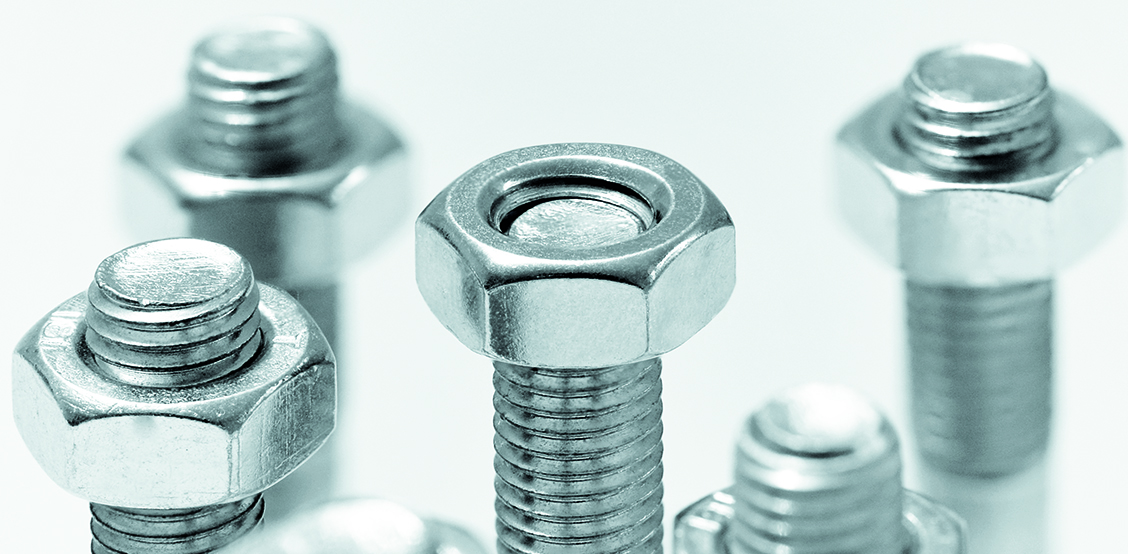Inhalt
01.
Milliardenfach bewährt
Es gibt viele Möglichkeiten, zwei Bauteile miteinander zu verbinden. Überall, wo eine Verbindung später wieder gelöst und aufs Neue hergestellt werden muss, ist die Schraube ohne Alternative. Sie ist vielseitig, erfüllt alle technischen Voraussetzungen und ist dabei noch kosteneffizient. Deshalb gehört sie zu den am häufigsten verwendeten Verbindungsmethoden, ist im Laptop ebenso anzutreffen wie in einem Flugzeug oder der Trägerkonstruktion einer Brücke.
Schrauben bieten gegenüber anderen klassischen Fügetechniken einen wesentlichen Vorteil: Sie sind lösbar. So ermöglichen sie überhaupt erst Reparaturen, Wartungsarbeiten oder Umbauten. Hinzu kommt: Auch der Wiederverwertung von Bauteilen legen Sie – im Gegensatz etwa zu Klebstoff, Nieten oder Schweißverbindungen – keine Steine in den Weg. Nicht zuletzt lassen sich Schraubengeometrie und die verwendete Metalllegierung optimal auf die zu verbindenden Komponenten und die im späteren Betrieb zu erwartenden Belastungen anpassen.
02.
Beispiele gängiger Schraubentypen
- Blechschraube
- Maschinenschraube sechskant
- Maschinenschraube innensechskant
- TORX®
- Dehnschraube
Gut, zu wissen: Eine Schraubenverbindung zeichnet sich dadurch aus, dass sie kraftschlüssig ist. Eine Ausnahme stellt die Scherlochleibungsschraubverbindung dar. Bei diesen Verschraubungen steht nicht die axiale Betriebssicherheit im Vordergrund sondern die Querkräfte. Sie wird vorwiegend in Stahlkonstruktionen verwendet und ist nicht gleitfest ausgelegt.
Die Schraube verbindet zwei oder mehr Bauteile auf eine Weise, dass sie sich selbst unter Belastung wie eines verhalten. So verhindert die Schraube eine unerwünschte Gegeneinander-Verschiebung der zu verbindenden Komponenten.
Bei der Berechnung der für die erforderliche Klemmkraft nötigen Vorspannkraft müssen Reibungsverluste im Gewinde und unter dem Schraubenkopf berücksichtigt werden. Und nicht zuletzt gilt es, eine Schraubenverbindung zu wählen, die die angestrebte Vorspannkraft erzielt und unter Betriebsbedingungen aufrechterhält. Denn: Schrauben unterscheiden sich nicht nur nach Schraubprofilen, sondern unter anderem auch nach Festigkeitsklassen. Diese geben Auskunft über die Belastbarkeit bzw. Zugfestigkeit einer Schraube und müssen ab einem Nenndurchmesser von 5 mm auf der Schraube selbst ausgewiesen sein.
03.
Das Festigkeitsklasse-Kennzeichen
Das Festigkeitsklasse-Kennzeichen setzt sich aus zwei durch einen Punkt getrennten Werten zusammen. Die erste Zahl entspricht einem Hundertstel der Nennzugfestigkeit. Die zweite dem Zehnfachen des Verhältnisses zwischen unterer Streckgrenze und Nennzugfestigkeit.
Eine Schraube mit Festigkeitsklasse 8.8 beispielsweise besitzt eine Zugfestigkeit von 800 N/mm² und ein Streckgrenzenverhältnis von 0,8. Das Streckgrenzenverhältnis ist der Quotient zwischen oberer Streckgrenze (in diesem Fall 640 N/mm²) und einer max. Zugfestigkeit (in diesem Fall 800 N/mm²). Die Streckgrenze beschreibt den Wert, ab dem das Material zu fließen beginnt und es zum Bruch führt. Bis zum Erreichen der Zugfestigkeit darf sich die Schraube weder längen noch brechen.
2025© All Rights Reserved